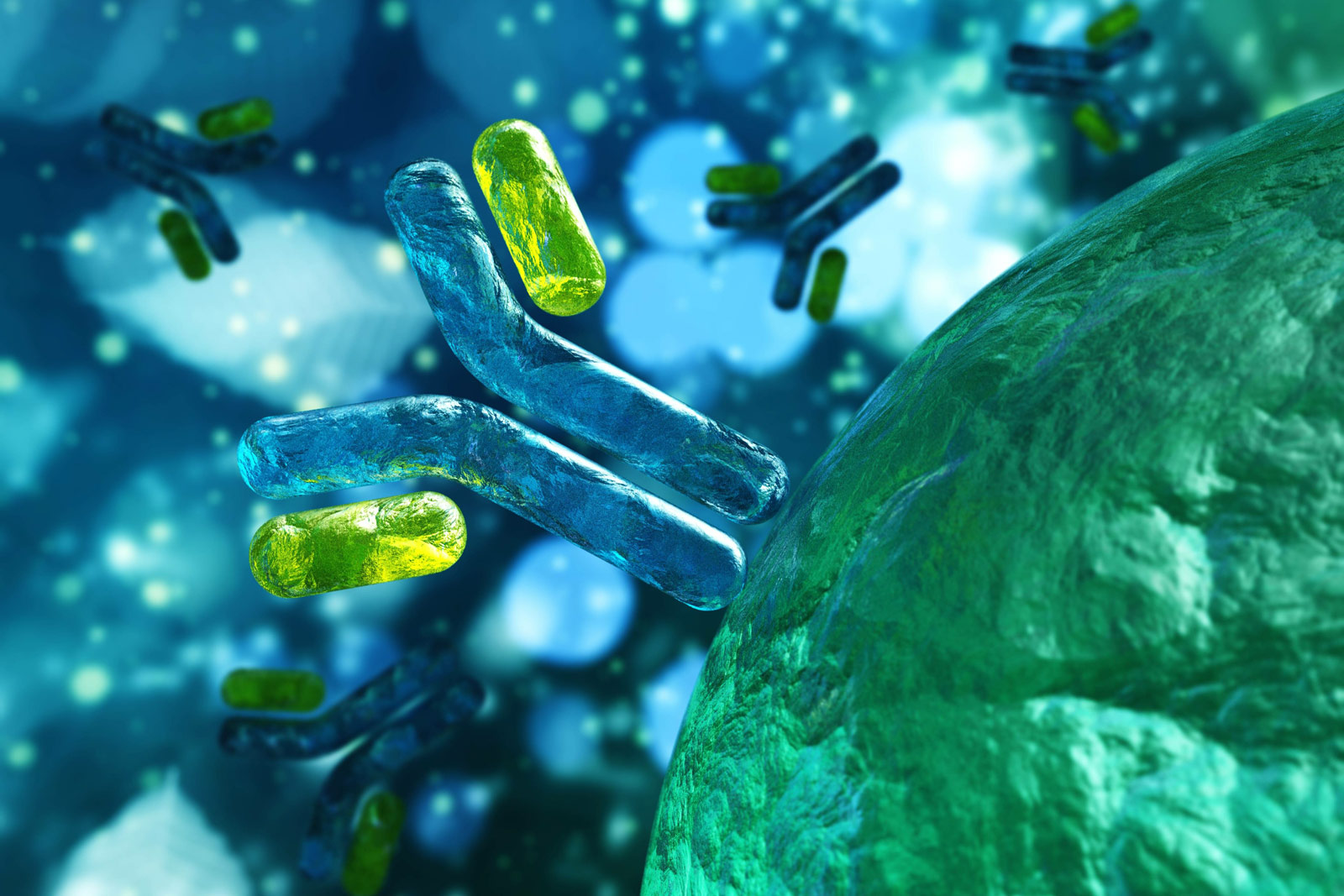Antikörper – auch "Immunglobuline" genannt – werden heute erfolgreich bei den verschiedensten Erkrankungen eingesetzt. Früher vor allem in Form von Impfungen zum Schutz vor Infektionskrankheiten verwendet, finden Antikörper mittlerweile einen breiten Einsatz in der Medizin, die über die reine Immunabwehr hinaus gehen. Möglich macht das die starke und spezifische Bindung an bestimmte Strukturen im menschlichen Körper.
Schutz der insulinproduzierenden Zellen
Bei der Therapie von verschiedenen Formen von Krebs haben Behandlungen mit Antikörpern die Überlebensraten deutlich erhöht. Daneben werden Antikörper-Medikamente unter anderem bei Infektionskrankheiten wie dem Atemwegsinfekt mit dem Respiratorische Synzytial-Virus und bei allergischen Krankheiten wie Dermatitis und Asthma eingesetzt. Bei Migräne werden sie vorbeugend verabreicht. Auch bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie Schuppenflechte, Multipler Sklerose und eben Typ-1-Diabetes liegen große Hoffnungen auf Antikörpertherapien. Bei Diabetes ist das Ziel, das Immunsystem so zu verändern, dass es die insulinproduzierenden Zellen nicht mehr zerstört.
Blockade von T-Zellen
Zum Einsatz kommen in der modernen Medizin vor allem sogenannte „monoklonale“ Antikörper, die sehr spezifisch wirken. Die Wirkstoffe erkennt man daran, dass sie auf -mab (für „monoclonal antibody“, deutsch für „monoklonaler Antikörper“) enden.
Teplizumab ist ein Anti-CD3-Antikörper, das heißt, er bindet sich an eine Oberflächenstruktur namens CD3 auf bestimmten T-Zellen im menschlichen Körper, die zwar eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr aber auch bei der Zerstörung der Betazellen in der Bauchspeicheldrüse spielen, die Insulin produzieren. Durch die Bindung an den Antikörper werden diese Zellen blockiert und die Betazellen länger erhalten. Da T-Zellen die Aufgabe haben vor Infektion mit Viren zu schützen, steigt unter der Behandlung mit Teplizumab allerdings auch das Infektionsrisiko.
Die Stadien von Diabetes Typ 1

Diabetes Typ 1 entwickelt sich schrittweise über mehrere Stadien, oft lange bevor erste Symptome auftreten.
- Stadium 1: In diesem frühen Stadium sind bereits Autoantikörper im Blut nachweisbar, die auf eine Fehlsteuerung des Immunsystems hindeuten. Der Blutzucker ist noch normal, und es gibt keine spürbaren Symptome. Dennoch hat der Körper bereits begonnen, die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse anzugreifen.
- Stadium 2: Hier zeigen sich erste Veränderungen im Zuckerstoffwechsel. Der Blutzucker kann nach dem Essen oder bei einem Glukosetoleranztest erhöht sein. Betroffene bemerken in der Regel noch keine Beschwerden, doch die Schädigung der insulinbildenden Zellen schreitet weiter voran. Hier wird eine Teplizumab-Therapie üblicherweise begonnen.
- Stadium 3: In diesem Stadium treten die typischen Symptome wie starker Durst, häufiges Wasserlassen, Gewichtsverlust und Müdigkeit auf. Der Blutzucker ist dauerhaft erhöht, und es wird die Diagnose „Diabetes Typ 1“ gestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Insulintherapie notwendig, um den Blutzucker zu regulieren.
Therapiebeginn in Stadium 2
In den USA ist Teplizumab (Markenname "Tzield") seit 2022 zur Verzögerung von Diabetes Typ 1 in Stadium 2 zugelassen. Das Medikament wird als intravenöse Infusion einmal täglich an 14 aufeinanderfolgenden Tagen verabreicht. An der Studie, die zur Zulassung geführt hatte, beteiligten sich Kinder und junge Erwachsene, die sich damals auch in diesem Stadium von Typ-1-Diabetes befanden.
In Stadium 1 lassen sich im Blut der Kinder Marker finden, die eine spätere Erkrankung an Typ-1-Diabetes wahrscheinlich machen. In Stadium 2 sind die Zuckerwerte leicht erhöht und die Insulinproduktion etwas eingeschränkt, der Langzeitblutzucker ist noch im normalen Bereich. Erst in Stadium 3 kommt es zu den typischen Symptomen eines Diabetes.
Zuverlässigkeit von Antikörpertests

Antikörpertests können frühzeitig Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Typ-1-Diabetes geben. Sie weisen spezielle Autoantikörper im Blut nach, die gegen die insulinproduzierenden Zellen gerichtet sind. Das Vorhandensein von einem Antikörper allein bedeutet aber nicht, dass die Krankheit sicher ausbricht! Erst wenn mehrere Antikörper nachgewiesen werden, steigt das Risiko deutlich. Die Wahrscheinlichkeit, einen Typ-1-Diabetes zu entwickeln, liegt erst dann bei ca. 80 %.
Die Tests ermöglichen es also, die Krankheit in einem sehr frühen Stadium zu erkennen, besonders bei familiärer Vorbelastung. Eine 100%ige Vorhersage liefern sie jedoch nicht.
Verzögerung um rund zwei Jahre
Mittels einer Behandlung mit Teplizumab konnte laut dieser Veröffentlichung der Beginn des Stadiums 3 um rund zwei auf vier Jahre hinausgezögert werden, genauer gesagt von 24 auf 48 Monate. Dies werten die Autoren der Studie als deutlichen Gewinn an Lebensqualität in einer wichtigen Entwicklungsphase. Das durchschnittliche Alter der Studienteilnehmer lag bei 14 Jahren.
Die Teilnehmer kamen aus Familien mit weiteren Fällen von Diabetes Typ 1. In Deutschland könnte man diese Kinder beispielsweise durch ein Screening ermitteln, das im Rahmen der Fr1da-Studie Eltern in einigen Bundesländern angeboten wird. Die Risiken der Behandlung wie Infektionen sind nach Ansicht von Prof. Dr. Olga Kordonouri, der Ärztlichen Direktorin des Kinder- und Jugendkrankenhauses „Auf der Bult“ in Hannover, gut vorherseh- und handhabbar, wie sie auf der Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft vortrug. Die Diabetes-Verzögerung mit Teplizumab bleibe zwar nicht ohne Nebenwirkungen, die Kosten-/Nutzenbilanz sei jedoch insgesamt positiv.
Nebenwirkungen von Teplizumab

In klinischen Studien traten bei nahezu allen Patienten unerwünschte Ereignisse auf. Diese waren überwiegend leicht bis mäßig, vorübergehend und behandelbar. Etwa 6–7 % der Patienten in der Teplizumab-Gruppe setzten die Therapie wegen Laborabweichungen oder asymptomatischen Befunden ab.
Am häufigsten kommt es zu einem vorübergehenden Rückgang bestimmter weißer Blutkörperchen (Lymphopenie, Häufigkeit: ca. 73–78 %). Viele Betroffene berichten auch über Hautausschläge, Müdigkeit oder Kopfschmerzen.
In einigen Fällen kann es zu einer sogenannten „Zytokinfreisetzungsreaktion“ (CRS) kommen – das ist eine Art Immunreaktion mit Fieber, Gliederschmerzen oder Übelkeit. Diese tritt meist in den ersten Tagen der Behandlung auf und klingt rasch wieder ab.
Selten zeigen sich erhöhte Leberwerte, die bei bestimmten Grenzwerten zu einem Abbruch der Therapie führen können. Auch die Reaktivierung von Viren wie dem Epstein-Barr-Virus ist möglich.
Ein leicht erhöhtes Risiko für diabetische Ketoazidose (DKA) wurde in Metaanalysen beobachtet (2,3 % vs. 1 % der Kontrollgruppe), jedoch zeigte sich dieser Risikoanstieg nicht in der wichtigsten TN‑10-Studie.
Die Therapie erfordert deshalb eine engmaschige ärztliche Überwachung während und kurz nach der Behandlung.
Hohe Kosten
Sollte das Präparat auch in Deutschland zugelassen werden, stehen dem breiten Einsatz vor allem zwei Dinge entgegen: Zum einen die Kosten von knapp 200.000 Dollar pro Kind. Zum anderen müsste zunächst ein deutschlandweites Screening auf Antikörper umgesetzt werden, um überhaupt entsprechenden Kandidaten für die Behandlung rechtzeitig zu finden - immer verbunden mit dem Risiko, dass der Diabetes bei mind. einem Fünftel der Antikörper-Träger gar nicht ausbricht.
Bei den Diabetikern Niedersachsen wird der Themenkreis bereits länger intensiv diskutiert. Weitere informative Artikel zum Thema finden sich im folgenden Kasten.