Antikörperscreenings zur frühzeitigen Erkennung von Typ-1-Diabetes sind derzeit in aller Munde – sowohl in medizinischen Fachkreisen als auch in interessierten Teilen der Öffentlichkeit. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob durch flächendeckende Tests auf diabetesrelevante Autoantikörper lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisungen verhindert und der Krankheitsausbruch sinnvoll verzögert werden können.
Erste Studien, unter anderem aus Bayern und den USA, zeigen vielversprechende Ergebnisse. Gleichzeitig werfen ethische, medizinische und gesellschaftliche Aspekte Fragen auf: Wie geht man mit einem positiven Befund um? Welche Konsequenzen hat dieser für die Familie? Und wer trägt die Kosten für solche Screenings?
Was bislang vor allem ein Thema in Fachgremien war, ist inzwischen auch in den sozialen Medien, in Elternforen und im Gesundheitsteil großer Zeitschriften angekommen. Die Unsicherheit wächst – ebenso wie der Informationsbedarf.
Angesichts der zunehmenden Anfragen von Journalisten hat der Landesvorstand der Diabetiker Niedersachsen nun reagiert. In einem Positionspapier beziehen wir Stellung zur aktuellen Diskussion und erläutern unsere Haltung zum Thema.
Positionspapier
Antikörper-Screenings auf eine potenzielle Typ-1-Diabetes-Erkrankung
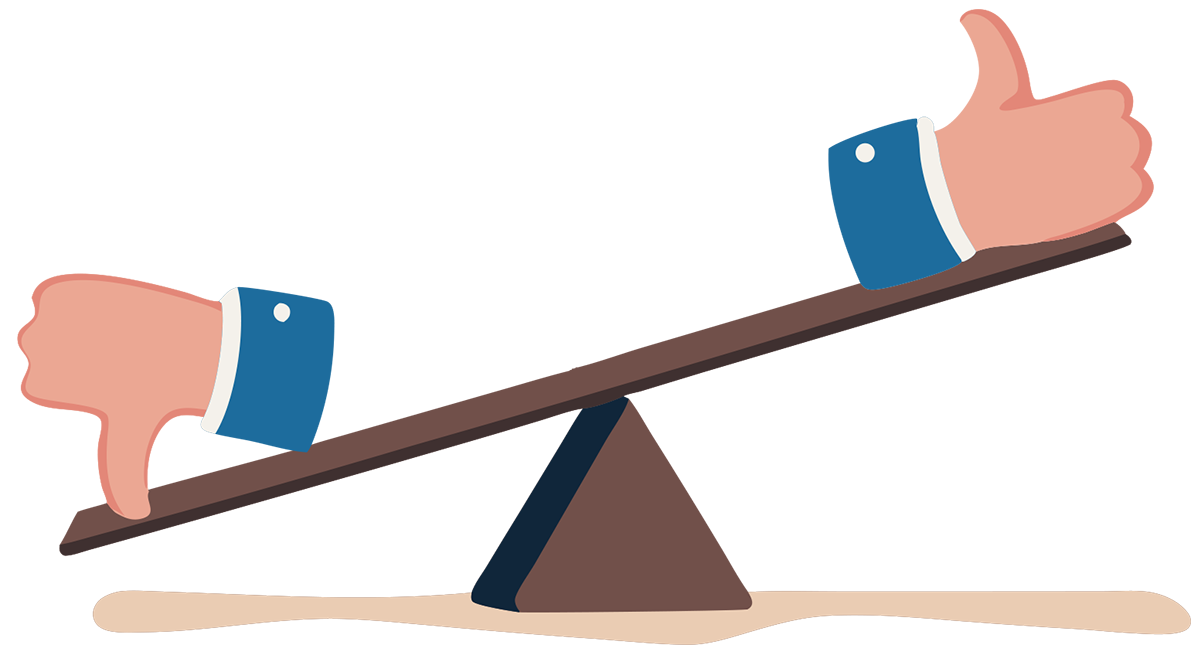
Die Debatte um die Früherkennung von Diabetes Typ 1 bei Kindern scheint uns oft von falschen Erwartungen und Hoffnungen geprägt. Wir möchten deshalb in diesem Positionspapier aufschlüsseln, was die Früherkennungstests können, was nicht und wie wir sie aus Patientensicht einordnen.
Das sogenannte „Islet-Autoantikörper-Screening“ bietet zwar eine gute Vorhersagekraft für ein Diabetesrisiko, aber es ist nicht 100% zuverlässig. Nicht jeder mit Antikörpern entwickelt tatsächlich Diabetes. Wir stehen im steten Austausch mit unseren Mitgliedsfamilien zur Thematik und haben auch den umgekehrten Fall berichtet bekommen. Bei einem Test eines Kleinkindes wurden keine Antikörper gefunden, das Kind erkrankte aber trotzdem nicht mal ein Jahr später an einem Diabetes Typ 1.
Von den Befürwortern der Ausweitung der Screenings wird immer wieder als Schlüsselargument vorgetragen, dass das Screening als Regel in den Vorsorgeuntersuchungen Ketoazidosen verhindern würde. Im geschilderten Fall war es aber so, dass die Eltern aufgrund ihrer Kenntnisse über die Symptome eines Diabetes Typ 1 entsprechend reagierten, nicht weil der Antikörper-Test zuverlässig Aufschluss gegeben hätte.
Auch das genetische Screening (die sogenannte „HLA-Typisierung“) kann nur eine Risikoeinschätzung liefern, aber keinesfalls eine hundertprozentig verlässliche Aussage, ob es zur Entwicklung eines Typ-1-Diabetes kommt oder nicht.
Die Unzuverlässigkeit der Tests und die emotionale und psychische Belastung, die mit einem positiven, aber nicht 100 Prozent aussagekräftigen, Ergebnis einhergehen, sprechen aus unserer Sicht gegen ein Regel-Screening im Rahmen von U-Untersuchungen, oder eine komplette Kostenübernahme durch die Gesetzlichen Krankenkassen für alle. Und: Wer mit seinem Kind an einer Studie teilnimmt oder bei wem ein konkreter Verdacht vorliegt, der bekommt bereits die Kosten übernommen.
Im Austausch mit unseren Mitgliedsfamilien ergibt sich ein diverses Bild. Viele sehen rückblickend keinen Vorteil, den ihnen das Screening gebracht hätte, andere hingegen schon. Einigkeit herrscht aber darüber, dass vor allem Kinderärzte und Kliniken aufmerksamer beim Vorhandensein konkreter Symptome sein sollten. Noch immer werden Familien, in denen ein Kind durch Gewichtsverlust, ständigen Durst, häufiges Wasserlassen oder einfach ständige Abgeschlagenheit auffällt, ohne Blutzuckerkontrolle, Glukose-Toleranztest oder HbA1c-Kontrolle wieder nach Hause geschickt. Nicht selten liegt das Kind kurze Zeit später mit einer Ketoazidose im Krankenhaus. Das ist unseres Erachtens derzeit die viel größere Baustelle.
Hinzu kommt, dass aus unserer Sicht das Hauptmotiv von Regelscreenings die effektive Diabetesprävention sein sollte. Es steht jedoch derzeit keine dauerhaft präventive Therapie für Typ-1-Diabetes zur Verfügung. Das Medikament Teplizumab ist zwar ein Durchbruch in der Antikörpertherapie-Forschung, verschiebt den Ausbruch der 3. Phase der Krankheit aber im Schnitt nur um 2 Jahre. Zu den beschriebenen häufigeren Nebenwirkungen wie Fieber, Hautausschlägen, Kopfschmerzen und Übelkeit kommt eine erhöhte Infektanfälligkeit, v. a. durch Immunmodulation. Das heißt, zwei Jahre keine Diabetes-Symptomatik, aber dafür andere gesundheitliche Einschränkungen, in sehr seltenen Fällen sogar Leberschäden und schwere allergische Reaktionen. Unseres Erachtens ein hoher Preis, der gut abgewogen sein sollte. Zumal die Langzeitwirkungen der Antikörpertherapie bisher nicht erforscht sind.
Derzeit ist Teplizumab nur in den USA zugelassen. Seine Anwendung ist sehr teuer (ca. 200.000 Euro pro Person) und in Deutschland derzeit nur über das Härtefallprogramm des Paul-Ehrlich-Instituts möglich. Letzteres verwundert, ist dieses Programm doch eigentlich nur für Patienten gedacht, die unter einer lebensbedrohlichen Krankheit leiden, mit bereits zugelassenen Therapien nicht zufriedenstellend behandelt werden können und für die es keine therapeutische Alternative mehr gibt.
Alles in allem ist für uns der Mehrwert von Antikörper-Screenings als Teil der Regelversorgung aus Patientensicht derzeit nicht ersichtlich. Wir setzen in erster Linie auf eine bessere Aufklärung über das gesteigerte Diabetes-Typ-1-Risiko bei genetischer Prädisposition und die Sensibilisierung von Eltern und Behandlern für mögliche Symptome, damit die Zahl an lebensbedrohlichen Ketoazidosen effektiv verringert werden kann. In diesem Sinne lehnen wir Antikörper-Screenings nicht grundsätzlich ab, betrachten diese aber als ein freiwilliges Angebot, für das es bei den relevanten Gruppen ja bereits Kostenerstattung gibt.
Hinweis: Die gemachten Angaben zu Nebenwirkungen von Teplizumab beziehen sich auf die TN-10-Studie, die zur FDA-Zulassung führte.


